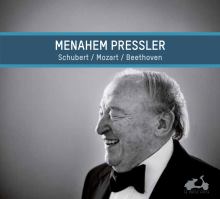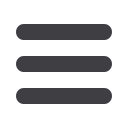

49
MENAHEM PRESSLER
Beethoven wiederum verdichtet seine Rede.
Wie bringt er die Mauern, mit denen der
Klassizismus ihn umstellt, zum Einsturz? Was nutzt denn eine neue Sprache, wenn der
Instrumentenbau sie bei ihrer Suche nach neuen Klängen nicht begleitet? Auf der
Sonate
Pathétique
steht in der Tat: „für Pianoforte oder Cembalo“. Die Tastatur ist weiterhin ein
Werkzeug, mit dem Beethoven das Menschheitstheater malt und es zum ersten Male
wagt, sich nicht mehr an Gott zu wenden. (Aber sagt er den Musikern nicht zugleich auch:
„Was habe ich mit euren miserablen Instrumenten zu schaffen, wo doch in mir der Geist
weht“…?). Er bewundert Bach und bedauert, nicht mit Mozart gearbeitet zu haben.
In den Straßen Wiens kreuzen sich bisweilen Schuberts und Beethovens Wege,
doch wagt es Schubert nicht, Beethoven anzusprechen.
Der Komponist des
Erlkönigs
reißt die Maske hinunter, denn seine Bemühungen berühren das Wesen der Musik selbst:
Wo ist der Platz des Künstlers in der Gesellschaft, wenn dieser, unter Einsatz des Lebens,
seiner Kunst nachgehen möchte, ohne von einem Auftrag abzuhängen? Wie Beethoven,
aber verbunden mit mehr Schmerz und Wut, spielt er mit Momenten der Stille und mit
Unausgesprochenem. Was Wien tolerieren kann, aber nicht sehen will, was Metternichs
Polizei anweist, der Kaiser jedoch unterstützt, unter der Feder Beethovens sowie der Feder
Schuberts nimmt es Form an.
Die sich kreuzenden Wiener Geschichten, so nah
beieinander in Zeit und Raum, konnten nur an den
Ufern eines Flusses entstehen, der die neue Kraft
Europas weiterträgt. Im Jahre 1800 funkelt Wien.
Manch einer erblickt darin die Generalprobe zu
dem dann folgenden Jahrhundert.